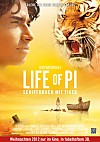Filmkritik: "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger"
Geschrieben am Montag 31 Dezember 2012 um 17:51 von Roland Freist
![]()
Schwimmbecken mit Tiger
Hier kommt einer der poetischsten Filme des Jahres, ein Märchen, das sich anfühlt, als sei es der reichen Mythologie Indiens entnommen. Ein Junge treibt zusammen mit einem Tiger monatelang orientierungslos auf dem Meer, sie bilden eine Notgemeinschaft, hungern gemeinsam, haben Angst, Durst, und finden doch immer wieder Wege, um zu überleben. Doch zum Schluss stellt sich heraus, dass --- Stopp! Keine Spoiler an dieser Stelle.
Also noch einmal von Anfang an: Die Hauptperson, Pi (Suray Sharma), heißt eigentlich Piscine, wie das französische Wort für Swimming Pool. Da seine Klassenkameraden diesen Namen jedoch voller Wonne wie "Pisser" aussprechen, verkürzt er ihn schon bald zu Pi. Wohl um seinen Spitznamen vollends vergessen zu machen, eignet er sich in der Folge ein umfassendes Wissen über die Zahl Pi an und lernt unter anderem Dutzende ihrer Nachkommastellen auswendig.
Pis Vater (Adil Hussain) besitzt einen Privatzoo in Indien. Hier lebt auch ein Tiger, der infolge eines bürokratischen Irrtums den Namen Richard Parker trägt. Pi ist fasziniert von dem Tier, doch sein Vater zeigt ihm in einer eindringlichen Demonstration, dass es sich um ein gefährliches Raubtier handelt, und lässt den Tiger vor den Augen des Jungen eine Ziege töten und fressen.
Pi entwickelt sich zum Vegetarier. Der lange erste Teil des Films zeigt ihn bei seiner Suche nach Spiritualität, nacheinander probiert er es mit dem Christentum, dem Islam und dem Hinduismus. Zum Glück behält der Film immer seinen leichten Ton bei – Pis Familie begleitet seine religiösen Experimente mit der Bemerkung, dass sein Jahr, wenn er so weitermache, bald nur noch aus religiösen Feiertagen bestehe.
Wenn Sie sich beim Lesen des Artikels langsam fragen, wann denn endlich der Teil mit dem Schiffbruch und dem Tiger auf hoher See kommt – das Gleiche habe ich mich im Kino auch gefragt.
Da sich der Zoo finanziell nicht mehr rechnet, entschließt sich die Familie, nach Kanada auszuwandern. Die Tiere nehmen sie mit, da sie sie in der neuen Heimat teurer verkaufen können. Doch eines Nachts während eines Unwetters kentert das Schiff, und lediglich Pi, der Tiger Richard Parker, ein Gorilla, ein Zebra und eine Hyäne können sich mit einem Rettungsboot in Sicherheit bringen.
Es beginnt eine 227 Tage lange Odyssee. Schon bald sind nur noch Pi und der Tiger am Leben. Zu essen gibt es zumindest für den Jungen genug: Das Rettungsboot ist für 30 Personen ausgelegt und enthält daher ausreichend Schiffszwieback und Frischwasser, um ihn längere Zeit am Leben zu erhalten. Der Film erzählt in der Folge, wie Pi und der Tiger lernen, miteinander umzugehen, wie er Methoden entwickelt, Regenwasser aufzufangen und Fische aus dem Meer zu ziehen. Die Fahrt des Jungen und seines tierischen Begleiters in einer unbekannten Umgebung erinnert nun teilweise an ein Fantasy-Abenteuer. Regisseur Ang Lee ("Tiger and Dragon", "Brokeback Mountain") verstärkt diesen Eindruck noch durch die warmen Farben, in denen er die windstillen Tage auf dem spiegelglatten Meer dreht, sowie durch Lichteffekte wie das geheimnisvolle Fluoreszieren von Fischen und Quallen bei Nacht.
"Life of Pi" nutzt die Möglichkeiten der digitalen Tricktechnik voll aus, setzt die Effekte jedoch überlegt und sinnvoll ein, ohne damit zu protzen. So ist beispielsweise der Tiger in nahezu allen Aufnahmen erst nach den Dreharbeiten am Computer entstanden, wirkt jedoch in keinem einzigen Moment wie ein künstliches Wesen. Zudem hat Ang Lee den Film in 3D gedreht. Und auch diese Technik verwendet er nur für solche Szenen, bei denen sie eine echte Verbesserung bringt. Auf diese Weise sind einige atemberaubende Aufnahmen entstanden, in denen etwa die Kamera unter der Wasseroberfläche nach oben zielt und das Boot in der Luft zu schweben scheint. Neben Camerons "Avatar" und Scorseses "Hugo Cabret" ist dies der dritte Film, bei dem sich die Investition in eine 3D-Aufführung lohnt. Es braucht offensichtlich einen wirklich guten Regisseur, um diese Technik sinnvoll zu nutzen.
Der Film passt sich in seinem Rhythmus der gemächlichen Dünung des Ozeans an. Die Geschichte wird als Rückblende gezeigt, der ältere, erwachsene Pi erzählt sie einem jungen kanadischen Schriftsteller, der vermutlich für Yann Martel stehen soll, den Autor der Romanvorlage. Der Zuschauer weiß also von vornherein, dass Pi überleben wird, und kann sich auf das Geschehen im und rund um das Rettungsboot konzentrieren. Der Film trägt, wie anfangs bereits gesagt, märchenhafte Züge, und ist andererseits vom Aufbau her ein klassischer Abenteuerstreifen, mit Schiffbruch, Robinsonade und Rettung.
Doch das Ende wirft alles um. Pi erzählt dort eine alternative Version der Geschichte, und man erkennt, dass man sich von den meisterhaft komponierten Bildern hat täuschen lassen. Dabei gibt der Regisseur, sieht man genau hin, durchaus versteckte Hinweise, die man jedoch als Zuschauer nicht richtig interpretiert. Durch die Enthüllungen am Schluss gewinnt der Film eine Tiefe, die ihn endgültig abrundet und sein wahres Thema enthüllt. Ohne den Schluss hätte ich "Life of Pi" vermutlich drei oder dreieinhalb Sterne gegeben, für einen ruhig erzählten, etwas zu langen Abenteuerfilm mit einer Handlung ohne große Überraschungen, tollen Bildern und einigen schönen Details. Doch seine volle Wirkung entfaltet er erst nach Ablauf der ganzen 127 Minuten Laufzeit, und man erkennt in der Rückschau, dass es hier um wesentlich mehr ging als um die Irrfahrt eines Jungen auf dem Ozean. Denn mal ehrlich: Hat wirklich irgendjemand geglaubt, dass ein hungriger Tiger ein leckeres menschliches Horsd'œuvre auslassen würde, bloß weil es Freundschaft mir ihm schließen will?
Der deutsche Trailer: