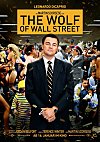Vampire unter sich
Wie muss es sich wohl anfühlen, wenn man Jahrhunderte alt ist? Was wird
aus einem Menschen, der sich bereits mit Shakespeare unterhielt, mit
Schubert musizierte und Eddie Cochran auf der Bühne sah? Wie würde er
leben, wie würde er sich ausdrücken? Wäre er ein fröhlicher Mensch, mit
wem würde er heute verkehren?
Das sind Fragen, wie sie sich Jim Jarmusch in seinem neuen Film stellt.
Es geht um zwei Vampire, die wohl nicht ganz zufällig Adam (Tom
Hiddleston, der Loki aus "Thor")
und Eve (Tilda Swinton) heißen. Sie sind ein Liebespaar, vermutlich
bereits seit Jahrhunderten, doch sie leben weit voneinander entfernt.
Adam hat ein heruntergekommenes Haus in einem der aufgegebenen
Außenbezirke von Detroit bezogen, wo er sich ein professionelles
Aufnahmestudio eingerichtet hat. Er ist Musiker und Sammler alter
E-Gitarren, zieht es jedoch vor, seine Werke nicht mehr zu
veröffentlichen. Eve wohnt in einem kleinen Apartment in der Altstadt
von Tanger in Marokko, zusammen mit Hunderten alter Bücher. Sie halten
per Videotelefonie Kontakt miteinander, Eve mit ihrem iPhone, Adam mit
einer selbstgebastelten Kombination aus Festnetztelefon und altem
Röhrenfernseher. Sie verbringt ihre Nächte in einer kleinen Bar, wo sie
Christopher Marlowe (John Hurt) trifft, den genialischen Dichter aus dem
16. Jahrhundert. Eine Verschwörungstheorie behauptet, er habe die Werke
von William Shakespeare geschrieben, was er im Film mit dem schönen Satz
"Ich wünschte, ich hätte diesen Kerl getroffen, bevor ich Hamlet
geschieben habe" bestätigt. Adam dagegen hat lediglich mit Ian (Anton
Yelchin, der Chekov in "Star Trek") Kontakt, einem langhaarigen Fan
seiner Musik, der ihm alles besorgt, was er zum Leben benötigt.
Bei einem ihrer Telefongespräche erwacht erneut die Sehnsucht in ihnen,
und Eve kommt Adam in Detroit besuchen. Sie bleiben für sich, reden über
alte Zeiten, tauschen Erinnerungen an Menschen aus, denen sie begegnet
sind, an Lord Byron oder Mary Shelley. Sie tragen Kleidungsstücke, die
sie teilweise bereits seit Jahrhunderten besitzen, und Eve neckt Adam
damit. Beide schlafen lange, man merkt ihnen an, dass sie alt sind und
ihre Kräfte schwinden. Blut nehmen sie nur noch wenig zu sich, am
liebsten Null negativ, "das gute Zeug", wie Eve es nennt, das Adam im
Krankenhaus bei einem korrupten Arzt kauft.
Es liegt eine unglaubliche Melancholie über diesen Szenen. Die Vampire,
ohnehin allergisch gegen Tageslicht, bevorzugen schummrige Beleuchtung.
Steigt die Wattzahl, setzen sie sofort ihre Sonnenbrillen auf. Adam ist
leicht depressiv, die meiste Zeit sitzen oder liegen Eve und er in
seinem Wohnzimmer, hören Musik und tauschen ab und zu ein paar Sätze
aus. Es geschieht so gut wie nichts, sie lassen einfach nur die Zeit
vergehen. Doch eines Tages taucht Eves Schwester Ava (Mia Wasikowska, "Alice
im Wunderland") auf, sie ist jünger und leicht punkig, und
zerstört das schwermütige Idyll.
Der Film lebt von der Stimmung seiner Bilder, den Blicken in die
zerfallenden Behausungen der beiden Protagonisten, vollgestopft mit
Erinnerungsstücken an zwei Leben, die bereits viel zu lange dauern. Adam
spielt mit dem Gedanken, seine Existenz zu beenden, und lässt sich eine
Revolverkugel aus Hartholz anfertigen. Eve und er sind hochgebildet,
wissen von jeder Pflanze und jedem Tier den lateinischen Namen, haben
unendlich viel gelesen und gelernt. Doch wenn sie nicht auffallen und
die Aufmerksamkeit der Menschen erregen wollen, können sie ihr Wissen
nur untereinander teilen. Sie sind Freaks mit dem Aussehen und dem
Weltschmerz einer Gothic-Rock-Gruppe und haben die Menschheit schon
lange aufgegeben.
Wie gesagt, es geschieht nicht viel in den 123 Minuten dieses Films. Man
kann noch nicht einmal von einer Liebesgeschichte sprechen, da man weder
erfährt, wie, wann und warum Adam und Eve zusammengefunden haben, noch
warum sie so weit voneinander entfernt wohnten. "Only Lovers Left Alive"
ist ein Stimmungsbild und zeigt zwei, nun ja, Lebewesen, die von der
Menschheit so enttäuscht sind, dass sie sich so weit wie möglich von ihr
zurückgezogen haben. Mehr nicht. Doch wer sich auf die verträumten und
düsteren Bilder einlässt, lernt hier eine ganz neue Interpretation des
alten Vampir-Mythos kennen.
"Only
Lovers Left Alive" in der IMDB
Der deutsche Trailer: